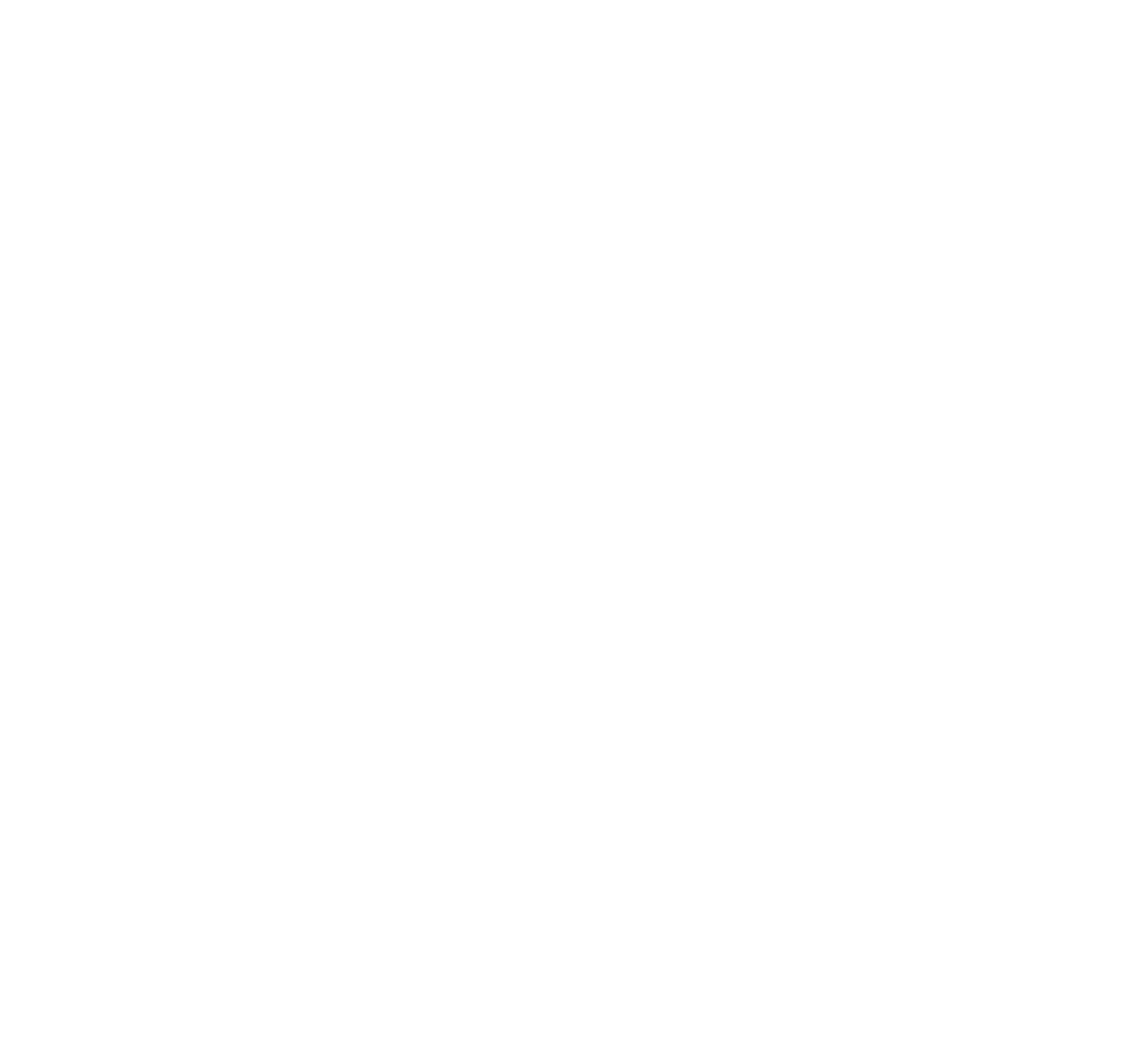Allein sitzt Violetta auf ihrem Krankenbett. Ihr Leben neigt sich dem Ende zu. Doch nein! Violetta will nicht sterben, und vor allem nicht hier und jetzt. Mühsam richtet sie sich auf und zieht sich an. Ein letzter Blick zurück zum Bett, dann schmeißt sie sich mit all ihrer verbliebenen Kraft ins schillernde Nachtleben. La traviata ist die Geschichte einer von der Gesellschaft ausgeschlossenen jungen Frau, die an den gesellschaftlichen Normen zerbricht.
Bei der Uraufführung 1853 geriet die Premiere zum Skandal – heute ist La traviata eine der meistgespielten Opern überhaupt – gerade weil sie so unmittelbar und menschlich ist. Giuseppe Verdi komponierte die Oper nach Alexandre Dumas’ Roman Die Kameliendame, der bereits bei seinem Erscheinen 1848 für Aufsehen sorgte: eine Kurtisane als Heldin, eine Liebesgeschichte, die nicht dem Idealbild der „reinen, tugendhaften Frau“ entsprach. Marguerite Gautier, die literarische Vorlage für Violetta Valéry, ist eine Frau der Pariser Halbwelt. Sie bewegt sich in Salons, in denen gefeiert, getrunken und geliebt wird. Mit ihrer Schönheit und Anmut zieht sie die Blicke der Männer auf sich, viele buhlen um ihre Gunst. Wer in die Gesellschaft nicht hineinpasst oder irgendwann herausfällt, ist schnell vergessen. Frauen – Kurtisanen – werden so lange bewundert, wie die Männer sie umwerben und hofieren können. Lässt sich das glanzvolle Bild der verführerischen Schönen nicht mehr aufrecht halten, schlägt Bewunderung schnell in Verachtung um. Die vergnügungssüchtige Gesellschaft stößt gnadenlos ihre Außenseiterinnen von sich. Historisches Vorbild für Violetta Valéry und Marguerite Gautier ist Alphonsine Plessis, später als Marie Duplessis bekannt. 1844 lernt der zwanzigjährige Alexandre Dumas die prominente Kurtisane Marie Duplessis kennen und verliebt sich in sie.
Für einige Monate wird sie seine Maitresse. Um mit ihrem Lebensstandard mithalten zu können, macht Dumas in dieser Zeit 50.000 Francs Schulden. Als die Beziehung in die Brüche geht, schreibt er seinen berühmten Abschiedsbrief an die Geliebte: „Meine liebe Marie – ich bin weder reich genug –, um Sie zu lieben, wie ich es wünschte, noch arm genug, um von Ihnen so geliebt zu werden, wie Sie es möchten. Vergessen wir also einander – Sie einen Namen, der Ihnen beinahe gleichgültig sein muss, und ich ein Glück, das für mich unmöglich geworden ist. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie traurig ich bin, Sie wissen ja, wie tief ich Sie liebe.“ Wenig später heiratet Marie Duplessis den reichen Edouard Comte de Perregaux. Die Trennung folgt jedoch bald und Marie stirbt 1847 im Alter von 23 Jahren allein und hochverschuldet an Tuberkulose. Ein persönliches Zusammentreffen zwischen ihr und Dumas gibt es nicht mehr. Noch im selben Jahr beginnt Dumas mit der Niederschrift der Kameliendame. Marie Duplessis.: „Warum ich mich verkauft habe? Weil ehrliche Arbeit mir niemals den Luxus erlaubt hätte, nach dem ich mich doch so sehr sehnte. Dabei bin ich weder verderbt, noch neidisch. Ich wollte nur die Freude, die Genüsse und Feinheiten einer eleganten und kultivierten Umgebung kennenlernen ... ich habe meine Freunde immer selbst gewählt, doch niemand hat meine Liebe je erwidert. Das ist das eigentlich Grausige an meinem Leben.“ Mehr noch als der Roman stieß Verdis La traviata bei ihrer Uraufführung 1853 auf große Kritik. Man wollte auf der Bühne keine zeitgenössischen Figuren sehen, keine „leichte Dame“ im Kleid der Gegenwart, keine Krankheit, die ungeschönt das Elend des menschlichen Lebens vor Augen führt. „Das ‚Ich will nicht sterben!‘ einer jungen Frau ist als Hauptmotiv dieser Oper eingeschrieben: ‚Gran Dio! Morir sì giovine…!’, ('Großer Gott! So jung sterben...!') begehrt Violetta gegen ein ungerechtes Schicksal, gegen einen unerbittlichen Gott auf. Verdi schreibt vor, dass sie das ‚impetuosa‘ singen soll, also als ein ungestümes, heftiges, stürmisches Aufbegehren im Angesicht des Todes. Da gibt es keine ultimative Verklärung, kein opernhaftes ‚Sterben in Schönheit‘ mit einem romantisch-belkantesk gesungenen Übergang in eine bessere Welt, auch keine versöhnende Erlösung durch den Tod. Die letzten Monate im Leben einer unheilbar kranken und von der bürgerlichen Gesellschaft aufgrund ihres moralisch anstößigen Lebenswandels ausgestoßenen Frau und ihre ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Sterben-Müssen werden in La traviata durch Verdis psychologischen Realismus empathisch als glaubwürdiges, konsequentes und in jeder Note ehrliches Musiktheater erzählt“, so Olivier Tambosi und Christiane Boesiger.
Regisseur und Bühnenbildner Olivier Tambosi entwirft gemeinsam mit Christiane Boesiger (Co-Regie) und Kostümbildnerin Lena Weikhard einen zentrierten Raum, in dem Violetta, ihre Krankheit, ihre Einsamkeit, ihr Wunsch nach Liebe und später nach einem bürgerlichen Leben in aller Härte auf die glitzernde Oberfläche der Pariser Gesellschaft prallen: Violettas rauschhafte Party-Exzesse, der Versuch eines bürgerlichen Lebens in Liebe mit Alfredo, dann die Trennung und Flucht zurück in die Welt des Scheins. Am Ende steht Violettas einsamer Tod. Die musikalische Leitung der traviata liegt bei Mark Rohde, der mit dieser Produktion seinen Einstand als Generalmusikdirektor am Mainfranken Theater gibt. Die kürzlich mit dem Opus Klassik für die beste Operneinspielung des Jahres ausgezeichnete Sopranistin Sophie Gordeladze wird als Violetta ihr Hausdebüt geben. Später in der Spielzeit wird sie außerdem als Nedda in Pagliacci zu sehen sein. Auch Tenor Juraj Hollý als Alfredo Germont steht zum ersten Mal auf der Bühne des Mainfranken Theaters.
Bei der Uraufführung 1853 geriet die Premiere zum Skandal – heute ist La traviata eine der meistgespielten Opern überhaupt – gerade weil sie so unmittelbar und menschlich ist. Giuseppe Verdi komponierte die Oper nach Alexandre Dumas’ Roman Die Kameliendame, der bereits bei seinem Erscheinen 1848 für Aufsehen sorgte: eine Kurtisane als Heldin, eine Liebesgeschichte, die nicht dem Idealbild der „reinen, tugendhaften Frau“ entsprach. Marguerite Gautier, die literarische Vorlage für Violetta Valéry, ist eine Frau der Pariser Halbwelt. Sie bewegt sich in Salons, in denen gefeiert, getrunken und geliebt wird. Mit ihrer Schönheit und Anmut zieht sie die Blicke der Männer auf sich, viele buhlen um ihre Gunst. Wer in die Gesellschaft nicht hineinpasst oder irgendwann herausfällt, ist schnell vergessen. Frauen – Kurtisanen – werden so lange bewundert, wie die Männer sie umwerben und hofieren können. Lässt sich das glanzvolle Bild der verführerischen Schönen nicht mehr aufrecht halten, schlägt Bewunderung schnell in Verachtung um. Die vergnügungssüchtige Gesellschaft stößt gnadenlos ihre Außenseiterinnen von sich. Historisches Vorbild für Violetta Valéry und Marguerite Gautier ist Alphonsine Plessis, später als Marie Duplessis bekannt. 1844 lernt der zwanzigjährige Alexandre Dumas die prominente Kurtisane Marie Duplessis kennen und verliebt sich in sie.
Für einige Monate wird sie seine Maitresse. Um mit ihrem Lebensstandard mithalten zu können, macht Dumas in dieser Zeit 50.000 Francs Schulden. Als die Beziehung in die Brüche geht, schreibt er seinen berühmten Abschiedsbrief an die Geliebte: „Meine liebe Marie – ich bin weder reich genug –, um Sie zu lieben, wie ich es wünschte, noch arm genug, um von Ihnen so geliebt zu werden, wie Sie es möchten. Vergessen wir also einander – Sie einen Namen, der Ihnen beinahe gleichgültig sein muss, und ich ein Glück, das für mich unmöglich geworden ist. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie traurig ich bin, Sie wissen ja, wie tief ich Sie liebe.“ Wenig später heiratet Marie Duplessis den reichen Edouard Comte de Perregaux. Die Trennung folgt jedoch bald und Marie stirbt 1847 im Alter von 23 Jahren allein und hochverschuldet an Tuberkulose. Ein persönliches Zusammentreffen zwischen ihr und Dumas gibt es nicht mehr. Noch im selben Jahr beginnt Dumas mit der Niederschrift der Kameliendame. Marie Duplessis.: „Warum ich mich verkauft habe? Weil ehrliche Arbeit mir niemals den Luxus erlaubt hätte, nach dem ich mich doch so sehr sehnte. Dabei bin ich weder verderbt, noch neidisch. Ich wollte nur die Freude, die Genüsse und Feinheiten einer eleganten und kultivierten Umgebung kennenlernen ... ich habe meine Freunde immer selbst gewählt, doch niemand hat meine Liebe je erwidert. Das ist das eigentlich Grausige an meinem Leben.“ Mehr noch als der Roman stieß Verdis La traviata bei ihrer Uraufführung 1853 auf große Kritik. Man wollte auf der Bühne keine zeitgenössischen Figuren sehen, keine „leichte Dame“ im Kleid der Gegenwart, keine Krankheit, die ungeschönt das Elend des menschlichen Lebens vor Augen führt. „Das ‚Ich will nicht sterben!‘ einer jungen Frau ist als Hauptmotiv dieser Oper eingeschrieben: ‚Gran Dio! Morir sì giovine…!’, ('Großer Gott! So jung sterben...!') begehrt Violetta gegen ein ungerechtes Schicksal, gegen einen unerbittlichen Gott auf. Verdi schreibt vor, dass sie das ‚impetuosa‘ singen soll, also als ein ungestümes, heftiges, stürmisches Aufbegehren im Angesicht des Todes. Da gibt es keine ultimative Verklärung, kein opernhaftes ‚Sterben in Schönheit‘ mit einem romantisch-belkantesk gesungenen Übergang in eine bessere Welt, auch keine versöhnende Erlösung durch den Tod. Die letzten Monate im Leben einer unheilbar kranken und von der bürgerlichen Gesellschaft aufgrund ihres moralisch anstößigen Lebenswandels ausgestoßenen Frau und ihre ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Sterben-Müssen werden in La traviata durch Verdis psychologischen Realismus empathisch als glaubwürdiges, konsequentes und in jeder Note ehrliches Musiktheater erzählt“, so Olivier Tambosi und Christiane Boesiger.
Regisseur und Bühnenbildner Olivier Tambosi entwirft gemeinsam mit Christiane Boesiger (Co-Regie) und Kostümbildnerin Lena Weikhard einen zentrierten Raum, in dem Violetta, ihre Krankheit, ihre Einsamkeit, ihr Wunsch nach Liebe und später nach einem bürgerlichen Leben in aller Härte auf die glitzernde Oberfläche der Pariser Gesellschaft prallen: Violettas rauschhafte Party-Exzesse, der Versuch eines bürgerlichen Lebens in Liebe mit Alfredo, dann die Trennung und Flucht zurück in die Welt des Scheins. Am Ende steht Violettas einsamer Tod. Die musikalische Leitung der traviata liegt bei Mark Rohde, der mit dieser Produktion seinen Einstand als Generalmusikdirektor am Mainfranken Theater gibt. Die kürzlich mit dem Opus Klassik für die beste Operneinspielung des Jahres ausgezeichnete Sopranistin Sophie Gordeladze wird als Violetta ihr Hausdebüt geben. Später in der Spielzeit wird sie außerdem als Nedda in Pagliacci zu sehen sein. Auch Tenor Juraj Hollý als Alfredo Germont steht zum ersten Mal auf der Bühne des Mainfranken Theaters.