Deutschland ist im Lockdown, Deutschland hat Angst. Angst vor einem Virus, vor dem Risiko, zu erkranken. Wir Deutschen sind eine als besonders ängstlich geltende Nation. Eine Annäherung an ein Gefühl – und seine Folgen.
Der Bezug war sorgsam gewählt, und er sollte noch dem allerletzten Zweifler das Ausmaß der Krise verdeutlichen: Während ihrer Fernsehansprache am vergangenen 18. März betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Corona-Pandemie sei für das gemeinsame solidarische Handeln die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Einschätzung sagt viel aus über die aktuelle Situation, aber sie veranschaulicht auch: Wir – das meint insbesondere wir Deutschen – leben seit Jahrzehnten in einer privilegierten Zeit. Uns geht es gut. Existenzielle und das Solidarsystem gefährdende Bedrohungen wie Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Vertreibung hat die Mehrheit von uns noch nie am eigenen Leib erfahren müssen.
Der Bezug war sorgsam gewählt, und er sollte noch dem allerletzten Zweifler das Ausmaß der Krise verdeutlichen: Während ihrer Fernsehansprache am vergangenen 18. März betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Corona-Pandemie sei für das gemeinsame solidarische Handeln die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Einschätzung sagt viel aus über die aktuelle Situation, aber sie veranschaulicht auch: Wir – das meint insbesondere wir Deutschen – leben seit Jahrzehnten in einer privilegierten Zeit. Uns geht es gut. Existenzielle und das Solidarsystem gefährdende Bedrohungen wie Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Vertreibung hat die Mehrheit von uns noch nie am eigenen Leib erfahren müssen.
In einem privilegierten Land
Wenn man in dieser privilegierten Zeit und in einem privilegierten Land aufwächst, noch dazu in einem stabilen sozialen Umfeld und im ohnehin beschaulichen Norden an der Ostsee wie ich, dann scheint die Kindheit kaum größere Beschwernisse bereitzuhalten. Wäre da nicht der starke Seewind. Oder der Regen. Oder die leidenschaftslose Außentemperatur, die an Weihnachten wie an Ostern selten merklich von zwölf Grad Celsius abweichen will.
Doch der Regen gehört auch zu einer ersten großen, geradezu physischen Krisenerfahrung, die man als junger Mensch meiner Generation machen konnte. Als im April 1986 der Atomreaktor von Tschernobyl explodierte, wurde ich eindringlich gewarnt: „Wenn du draußen bist und es zu regnen beginnt, dann lauf!“ Die Angst vor der Radioaktivität, die massenhaft in die Atmosphäre gelangt war, die Sorge, bei ungünstiger Witterung nicht schnell genug nach Hause zu kommen oder keinen trockenen Unterstand zu finden, sie begleiteten mich von da an für geraume Zeit.
Doch der Regen gehört auch zu einer ersten großen, geradezu physischen Krisenerfahrung, die man als junger Mensch meiner Generation machen konnte. Als im April 1986 der Atomreaktor von Tschernobyl explodierte, wurde ich eindringlich gewarnt: „Wenn du draußen bist und es zu regnen beginnt, dann lauf!“ Die Angst vor der Radioaktivität, die massenhaft in die Atmosphäre gelangt war, die Sorge, bei ungünstiger Witterung nicht schnell genug nach Hause zu kommen oder keinen trockenen Unterstand zu finden, sie begleiteten mich von da an für geraume Zeit.
Vor einem Stück Sahnetorte fürchtet sich niemand
Die Furcht, die die Corona-Pandemie bei vielen von uns auszulösen vermochte, scheint eine ganz ähnliche zu sein. Auch das Virus ist, wie die radioaktive Strahlung, ein unsichtbarer Feind mit potenziell tödlicher Energie. Es kann jeden treffen. Einen Schutzschild gibt es (noch) nicht.
Gemessen an der tatsächlichen Opferzahl freilich sollten uns gerade auch andere – vermeidbare – Risiken unseres Lebens Furcht einflößen. Doch können Sie sich ein Kontaktverbot und eine Ausgangsbeschränkung vorstellen, die uns beispielsweise davor schützen soll, uns mit Rauchern zu treffen? Immerhin sterben jährlich bis zu 140.000 Menschen in Deutschland an den Folgen dieses Lasters (Schätzung; Statistisches Bundesamt, 2019). Oder stellen Sie sich vor, jedes Stück Sahnetorte und jedes faul auf dem Sofa verlümmelte Wochenende würde mit einem Bußgeld geahndet. Vielleicht ließe sich damit die Zahl der rund 345.000 Toten pro Jahr in Deutschland signifikant reduzieren, die an den Folgen einer Herz-/Kreislauferkrankung sterben? (2017; Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes)
Gemessen an der tatsächlichen Opferzahl freilich sollten uns gerade auch andere – vermeidbare – Risiken unseres Lebens Furcht einflößen. Doch können Sie sich ein Kontaktverbot und eine Ausgangsbeschränkung vorstellen, die uns beispielsweise davor schützen soll, uns mit Rauchern zu treffen? Immerhin sterben jährlich bis zu 140.000 Menschen in Deutschland an den Folgen dieses Lasters (Schätzung; Statistisches Bundesamt, 2019). Oder stellen Sie sich vor, jedes Stück Sahnetorte und jedes faul auf dem Sofa verlümmelte Wochenende würde mit einem Bußgeld geahndet. Vielleicht ließe sich damit die Zahl der rund 345.000 Toten pro Jahr in Deutschland signifikant reduzieren, die an den Folgen einer Herz-/Kreislauferkrankung sterben? (2017; Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes)
Verstehen Sie mich nicht falsch
Aber bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich zählte selbst einmal zu den Rauchern und hege hier keine Antipathien. Ebenso gern esse ich auch Ungesundes – vom Faulenzen am Wochenende ganz zu schweigen. Und es liegt mir insbesondere fern, die Pandemie kleinzureden und notwendige Gegenmaßnahmen zu verunglimpfen.
Nein, die Pointe liegt woanders: Die Ursache, warum wir das Coronavirus fürchten, nicht aber das Nikotin oder die falsche Ernährung, ist in unserer Evolution begründet. Wir fürchten uns vor Bedrohungen, die gleichzeitig und unvermittelt eine große Zahl an Menschen betreffen. Denn für unsere Vorfahren war es lebensbedrohlich, plötzlich den ganzen Sozialverband ihrer Gruppe zu verlieren und sich allein durchschlagen zu müssen. Weniger Sorgen mussten sich unsere Urahnen hingegen machen, wenn Einzelne ihres Verbundes starben. Plätschert also der Tod wie ein kontinuierlicher Strom singulärer Ereignisse auf unsere Wahrnehmung ein, ist das weit weniger ängstigend, als wenn auf einmal viele Personen um uns herum sterben.
Nein, die Pointe liegt woanders: Die Ursache, warum wir das Coronavirus fürchten, nicht aber das Nikotin oder die falsche Ernährung, ist in unserer Evolution begründet. Wir fürchten uns vor Bedrohungen, die gleichzeitig und unvermittelt eine große Zahl an Menschen betreffen. Denn für unsere Vorfahren war es lebensbedrohlich, plötzlich den ganzen Sozialverband ihrer Gruppe zu verlieren und sich allein durchschlagen zu müssen. Weniger Sorgen mussten sich unsere Urahnen hingegen machen, wenn Einzelne ihres Verbundes starben. Plätschert also der Tod wie ein kontinuierlicher Strom singulärer Ereignisse auf unsere Wahrnehmung ein, ist das weit weniger ängstigend, als wenn auf einmal viele Personen um uns herum sterben.
Angst ist kein guter Ratgeber
Das heißt aber auch, dass Angst – oder ihr Ausbleiben – nicht unbedingt ein guter Ratgeber für das eigene Verhalten ist. Das kennt jeder, der unter Flugangst leidet, aber auf der Autobahn bei 200 Sachen frohen Mutes die Lichthupe betätigt.
Nachdem am 11. September 2001 in New York zwei entführte Boeings die Zwillingstürme des World Trade Center zum Einstürzen gebracht hatten, wichen viele US-Amerikaner vom Flugzeug auf das Auto als Verkehrsmittel für längere Inlandsstrecken aus. In den darauffolgenden drei Jahren kamen rund 1.600 Menschen in den Vereinigten Staaten bei Verkehrsunfällen ums Leben. In derselben Zeit gab es dort bei den kommerziellen Fluggesellschaften keinen einzigen tödlichen Unfall. Risikoforscher wie der Psychologe Gerd Gigerenzer sprechen deswegen von einem terroristischen „Zweitschlag“: Die Angst vor Anschlägen kann so tödlich enden wie der Terrorismus selbst.
Nachdem am 11. September 2001 in New York zwei entführte Boeings die Zwillingstürme des World Trade Center zum Einstürzen gebracht hatten, wichen viele US-Amerikaner vom Flugzeug auf das Auto als Verkehrsmittel für längere Inlandsstrecken aus. In den darauffolgenden drei Jahren kamen rund 1.600 Menschen in den Vereinigten Staaten bei Verkehrsunfällen ums Leben. In derselben Zeit gab es dort bei den kommerziellen Fluggesellschaften keinen einzigen tödlichen Unfall. Risikoforscher wie der Psychologe Gerd Gigerenzer sprechen deswegen von einem terroristischen „Zweitschlag“: Die Angst vor Anschlägen kann so tödlich enden wie der Terrorismus selbst.
Zweitschläge durch Covid-19
Welche Zweitschläge durch Covid-19 verursacht werden, zeichnet sich bereits ab. Auch Kunst und Kultur werden, neben vielen anderen Bereichen, erheblich leiden, kulturelle Angebote werden aussterben, Kunstschaffende werden vom Markt verschwinden. Und die Furcht vor einer Ansteckung wird viele von uns noch geraume Zeit begleiten, selbst wenn wir zu einem Alltag zurückgekehrt sind, der annähernd als normal bezeichnet werden darf.
Wird also künftig die Sorge neben uns im Kino sitzen und im Theater, wird sie uns auf Rockkonzerten begegnen, auf Weinfesten, im Restaurant, in der Supermarktschlange, im Fußballstadion? Nicht umsonst ist die „German Angst“ in den internationalen Sprachgebrauch eingegangen: Wir Deutschen sind eine als besonders ängstlich geltende Nation. In unserem Wortschatz finden sich von der Beklemmung und Sorge über die Furcht und Angst bis hin zur Panik und Phobie zahlreiche nuancierte Begriffe für dieses ungute Gefühl – ergänzt von vielen umgangssprachlichen Wörtern und Wendungen.
Wird also künftig die Sorge neben uns im Kino sitzen und im Theater, wird sie uns auf Rockkonzerten begegnen, auf Weinfesten, im Restaurant, in der Supermarktschlange, im Fußballstadion? Nicht umsonst ist die „German Angst“ in den internationalen Sprachgebrauch eingegangen: Wir Deutschen sind eine als besonders ängstlich geltende Nation. In unserem Wortschatz finden sich von der Beklemmung und Sorge über die Furcht und Angst bis hin zur Panik und Phobie zahlreiche nuancierte Begriffe für dieses ungute Gefühl – ergänzt von vielen umgangssprachlichen Wörtern und Wendungen.
Unsere Gefühle können instrumentalisiert werden
Bei alledem ist wenig sicher, aber eines klar: Unsere Angst kann vernünftig, aber auch völlig irrational sein. Sie kann uns schützen, aber auch ins Unheil jagen. Sie kann fehlen, wo sie angemessen wäre, und sie kann uns bei eigentlich geringen Risiken unnötig ausbremsen. Und sie kann leider auch instrumentalisiert werden, um unsere freiheitlichen und demokratischen Werte dauerhaft zu beschneiden und Maßnahmen durchzusetzen, die in angstfreien Zeiten undenkbar wären. Das ist – bisher – zwar noch kein deutsches Phänomen, doch in anderen Ländern ist es traurige Realität.
Was auf die Krise folgen kann
Noch einmal zurück zum Zweiten Weltkrieg: Nach dessen Ende, so hört und liest man es in diesen Tagen des Öfteren, sei der Kunst- und Kulturhunger groß gewesen. So groß, dass die Menschen, als das kulturelle Leben endlich wieder erwachte, in Scharen geströmt seien. Theater gespielt wurde in vielen Städten bereits 1945 wieder oder – wie in Würzburg – Anfang 1946, und wenn das Gebäude dafür nicht mehr existierte, dann nutzte man eben Notbehelfe in Aulen, Turnhallen, Kinos oder Gasthäusern.
Als dann mit dem Wirtschaftswunder der 1950er Jahre auch das Repräsentationsbedürfnis einer sich neu erfindenden, sich ihrer selbst versichernden Gesellschaft wuchs, entstanden die zahlreichen Theaterneu- und -wiederaufbauten, die unsere reiche Bühnenkultur bis heute beheimaten.
Als dann mit dem Wirtschaftswunder der 1950er Jahre auch das Repräsentationsbedürfnis einer sich neu erfindenden, sich ihrer selbst versichernden Gesellschaft wuchs, entstanden die zahlreichen Theaterneu- und -wiederaufbauten, die unsere reiche Bühnenkultur bis heute beheimaten.
Dass wir soziale Wesen sind, prägt unsere Ängste, aber auch unsere Kultur
Dieser Blick zurück in die Geschichte mag Anlass zur Hoffnung geben, dass unsere derzeitigen Beschränkungen die Wahrnehmung zumindest ein wenig für diejenigen Dinge schärfe, die unser Dasein auszeichnen und lebenswert machen. Denn wir sind nun einmal, von alters her, soziale Wesen. Das prägt unsere Ängste, aber auch unsere kulturelle Aktivität und Identität, die wir suchen und brauchen.
Kultur und das Kunstschaffen sind nicht nur ein „Lebensmittel“, wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem Europakonzert der Berliner Philharmoniker am vergangenen 1. Mai formulierte, sondern – gerade auch in Krisenzeiten – ein Überlebensmittel. Kultur und das Kunstschaffen sind unverzichtbar für ein freiheitliches politisches Wertesystem, das sich Demokratie nennt.
Mögen wir auch in dieser Hinsicht weiterhin in einer privilegierten Zeit und in einem privilegierten Land leben.
Kultur und das Kunstschaffen sind nicht nur ein „Lebensmittel“, wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem Europakonzert der Berliner Philharmoniker am vergangenen 1. Mai formulierte, sondern – gerade auch in Krisenzeiten – ein Überlebensmittel. Kultur und das Kunstschaffen sind unverzichtbar für ein freiheitliches politisches Wertesystem, das sich Demokratie nennt.
Mögen wir auch in dieser Hinsicht weiterhin in einer privilegierten Zeit und in einem privilegierten Land leben.
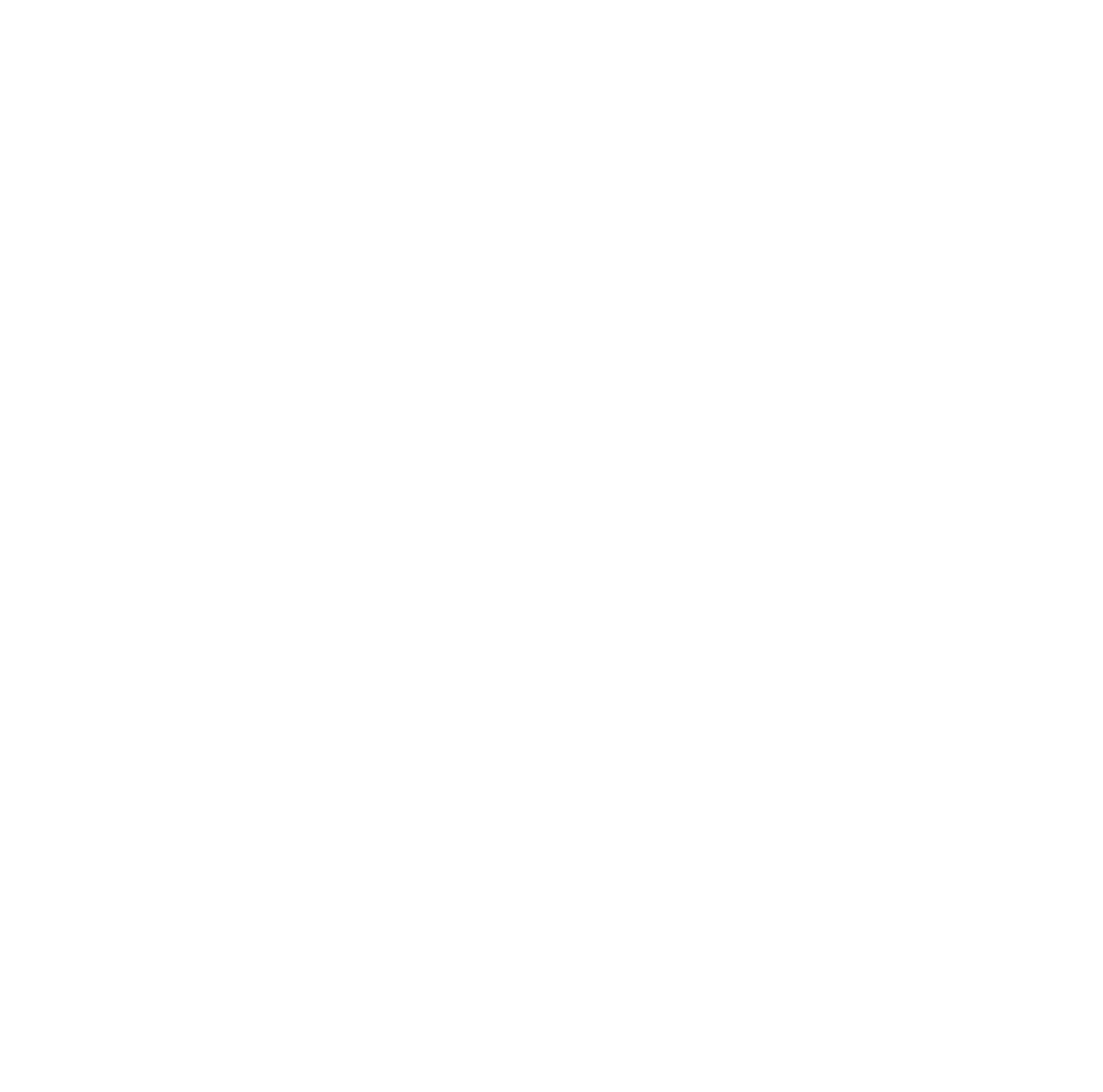
Kommentare
Ihr Kommentar
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.